Die Entstehung der eigentlichen Stadt
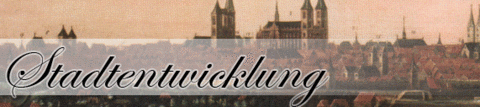
Mit der Entwicklung der Domburg verbunden ist die Entwicklung einer Stadtgemeinde. Dicht südöstlich der Domburg auf der südlichen Terrasse der Holtemme entwickelte sich die Marktsiedlung zur eigentlichen Stadt Halberstadt. Noch bis zur Zerstörung 1945 blieb ihr mittelalterlicher Stadtgrundriss mit seiner charakteristischen Straßenführung und Platzgestaltung erhalten.  989 erhält der Halberstädter Bischof Hildeward von König Otto III., dem Enkel Ottos des Großen, das Markt-, Münz-, Zoll- und Bannrecht. Die Verleihung dieser wichtigen Königsrechte an den Bischof förderte die weitere Ansiedlung von Handwerkern und Kaufleuten im Schutze der bereits bestehenden Bischofsburg (Domburg) nachhaltig. Sie kann heute zu Recht als die eigentliche Geburtsurkunde der Stadt Halberstadt angesehen werden. Wenn auch nicht endgültig durch historische Quellen bewiesen, kann man aber mit Sicherheit davon ausgehen, dass schon zum Zeitpunkt der Marktrechtsverleihung bereits eine kleine Handwerker- und Kaufleutesiedlung im Schutze der Bischofsburg bestanden hat. Darauf weist nicht zuletzt eine knapp ein halbes Jahrhundert später ausgestellte Urkunde Bischof Burchard I. (1036 1059) hin, in der Jener den Halberstädter Kaufleuten den bereits durch seine Vorgänger Arnulf (996 1023) und Brantog (1023 1036) mündlich zugesicherten Besitz von Wiesen am Hohen Wege urkundlich verbrieft. Wie sehr die Entwicklung der Marktsiedlung durch die königlichen Privilegien beschleunigt wurde, zeigt die Urkunde König Heinrich IV. von 1068 in der jener den Halberstädter Kaufleuten die Zollfreiheit auf allen königlichen Märkten des Reiches bestätigt. Dieses Privileg hat der König mit Sicherheit nur an Kaufleute verliehen, die bereits Handel im gesamten Reich betrieben und deshalb innerhalb des Standes der deutschen Kaufleute ein entsprechendes Ansehen genossen.
989 erhält der Halberstädter Bischof Hildeward von König Otto III., dem Enkel Ottos des Großen, das Markt-, Münz-, Zoll- und Bannrecht. Die Verleihung dieser wichtigen Königsrechte an den Bischof förderte die weitere Ansiedlung von Handwerkern und Kaufleuten im Schutze der bereits bestehenden Bischofsburg (Domburg) nachhaltig. Sie kann heute zu Recht als die eigentliche Geburtsurkunde der Stadt Halberstadt angesehen werden. Wenn auch nicht endgültig durch historische Quellen bewiesen, kann man aber mit Sicherheit davon ausgehen, dass schon zum Zeitpunkt der Marktrechtsverleihung bereits eine kleine Handwerker- und Kaufleutesiedlung im Schutze der Bischofsburg bestanden hat. Darauf weist nicht zuletzt eine knapp ein halbes Jahrhundert später ausgestellte Urkunde Bischof Burchard I. (1036 1059) hin, in der Jener den Halberstädter Kaufleuten den bereits durch seine Vorgänger Arnulf (996 1023) und Brantog (1023 1036) mündlich zugesicherten Besitz von Wiesen am Hohen Wege urkundlich verbrieft. Wie sehr die Entwicklung der Marktsiedlung durch die königlichen Privilegien beschleunigt wurde, zeigt die Urkunde König Heinrich IV. von 1068 in der jener den Halberstädter Kaufleuten die Zollfreiheit auf allen königlichen Märkten des Reiches bestätigt. Dieses Privileg hat der König mit Sicherheit nur an Kaufleute verliehen, die bereits Handel im gesamten Reich betrieben und deshalb innerhalb des Standes der deutschen Kaufleute ein entsprechendes Ansehen genossen.
 Halberstadt entstand, wie auch andere Städte, aus verschiedenen Siedlungskomplexen, die sich in Jahrhunderten herausbildeten. Diese wiesen Unterschiede in ihrer Wirtschafts- und Sozialstruktur auf, sowie in ihrer öffentlich rechtlichen Zugehörigkeit. Als der Bischofssitz errichtet wurde, bestand schon eine Siedlung, nordwestlich unterhalb der Bischofsburg.
Halberstadt entstand, wie auch andere Städte, aus verschiedenen Siedlungskomplexen, die sich in Jahrhunderten herausbildeten. Diese wiesen Unterschiede in ihrer Wirtschafts- und Sozialstruktur auf, sowie in ihrer öffentlich rechtlichen Zugehörigkeit. Als der Bischofssitz errichtet wurde, bestand schon eine Siedlung, nordwestlich unterhalb der Bischofsburg.
Sieht man von der Domburg ab, so sind die beiden Teile des ummauerten spätmittelalterlichen Ortes Halberstadt aus verschiedenen Elementen zusammengewachsen. Der Siedlungskern befand sich im Nordwesten der Domburg, dem sich im Osten eine Erweiterung anschloss, dazu kam das Westendorf. Diese drei Teile galten als Vogtei im weiteren Sinne, sie bildeten ein Kirchspiel. Ihre Bewohner unterstanden nicht dem Stadtrecht, sie trieben hauptsächlich Landwirtschaft. Die eigentliche Entwicklung der Stadt ging von der Marktsiedlung südöstlich der Domburg aus. Der gegen Ende des 10. Jahrhunderts errichtete Markt stellt die erste nichtagrariche Ansiedlung dar. Im Osten davon entwickelte sich im 12. Jahrhundert die Siedlung St. Paul und zu gleicher Zeit im Norden, entlang der Gröperstraße die Neustadt. Beide Siedlungen bildeten eigene Kirchspiele, ob sie jemals eigene Gemeinde darstellten ist höchst zweifelhaft, da für sie keine Bauermeister bezeugt sind. Ende des 12. Jahrhunderts, Anfang des 13. Jahrhunderts wurden sie der Marktsiedlung angegliedert und galten seitdem zusammen als Weichbild.
Das äußere Erscheinungsbild wurde insbesondere durch die 1186 erstmalig erwähnte Martinikirche geprägt. Der heutige Bau stammt aus der Zeit zwischen 1250 - 1350. Die Kirche diente nicht nur gottesdienstlichen Zwecken, sondern wurde auch als Versammlungsraum der Bürger und des Rates genutzt. Die ungleichen Türme, die bis heute ein Wahrzeichen der Stadt sind, gehörten zum System der Warten. Noch bis zum Jahre 1908 lebte ein Turmwächter im südlichen Turm. Die Türme waren immer Eigentum der Stadt. Die Bürgerkirche galt als Symbol für die Distanz zwischen Bürgertum und Bischof.
 Mit zunehmender Selbstständigkeit ihrer Bürger und ihrer Räte errangen die Städte in stetiger Auseinandersetzung mit ihren Stadtherren nach und nach in allen Bereichen Unabhängigkeit, neue Rechte und Freiheiten. Eine erste Bestätigung dieser Freiheiten und Rechte für die Stadt Halberstadt ist aus dem Jahre 1105 durch Bischof Friedrich I. erhalten. Durch den Eintritt in bedeutende Städtebünde und in die mächtige Hanse im 14. Jahrhundert erreichte die Stadt Halberstadt weitgehende diplomatische, wirtschaftliche und militärische Unabhängigkeit gegenüber dem Bischof.
Mit zunehmender Selbstständigkeit ihrer Bürger und ihrer Räte errangen die Städte in stetiger Auseinandersetzung mit ihren Stadtherren nach und nach in allen Bereichen Unabhängigkeit, neue Rechte und Freiheiten. Eine erste Bestätigung dieser Freiheiten und Rechte für die Stadt Halberstadt ist aus dem Jahre 1105 durch Bischof Friedrich I. erhalten. Durch den Eintritt in bedeutende Städtebünde und in die mächtige Hanse im 14. Jahrhundert erreichte die Stadt Halberstadt weitgehende diplomatische, wirtschaftliche und militärische Unabhängigkeit gegenüber dem Bischof.
Nach außen sicherte die neu entstandene Gemeinde ihr Gebiet mit einer Stadtmauer. Heute nur noch in Teilstücken erhalten, umschloss die Mauer mit ihren vier Kilometern Länge im Mittelalter das gesamte Stadtgebiet. Erbaut um 1220 hatte sie eine Höhe von 5,5 m und eine Breite von 1,9 m. Die sieben Tore gewährten Einlass in die Stadt. Die über 30 runden und eckigen Türme dienten der Verteidigung bei Angriffen. An der Innenseite befand sich ein hölzerner Wehrgang. Vor der Mauer gab es seit dem 13. Jahrhundert auch Gräben und Wälle. Zu den sieben Stadttoren führten feste Brücken oder Zugbrücken. Der anwachsende Verkehr und die Stadterweiterung bedingten Anfang des 19. Jahrhundert den Abriss.
Im Laufe der Jahrhunderte entwickelten sich verschiedene Siedlungskomplexe, die sich zu einer Gemeinde zusammen schlossen.

Nicht zuletzt das eigene Stadtwappen demonstriert die neu entstandene Stärke der Gemeinde. Aus den "burgensis civiatis" - den (einzelnen) Bürgern der Stadt - war in Nachbarschaften und Innungen und schließlich der gesamten Stadtgemeinde fest zusammengeschlossene Bürgerschaft geworden. Sie nannte sich jetzt stolz in ihren Urkunden (1239): "Communitas Halberstadensis" - die Gemeinschaft, die Kommune (der Bürger) Halberstadts!
Zentrum dieser Siedlung waren die beiden Märte, der Holzmarkt, 1275 erstmalig erwähnt und der 1478 erwähnte Kornmarkt 1478, seit 1784 trägt er den Namen Fischmarkt.
Zwischen diesen Marktplätzen stand das Rathaus als Verwaltungszentrum der neuen Stadtgemeine.
Bereits 1241 sprechen die Quellen von einem ersten Rathaus, wo dieses zu lokalisieren ist, konnte noch nicht sicher geklärt werden. Es ist davon auszugehen, dass besonders der Bereich um die Marktkirche St. Martini nach der Zerstörung Halberstadts 1179 durch Heinrich den Löwen eine neue Gestalt annahm. So ist der archäologische Befund eines in romanischer Art angelegten Pfeilertorsos dicht nördlich des jetzigen Rathauses, auf dem Grundstück Martiniplan 2, der während des Neuaufbaues des Stadtzentrums 1996/97 geborgen wurde, vorsichtig mit dem Vorgängerbau des Rathauses in Verbindung zu bringen.
 Nachdem bereits ein Vorgängerbau bestanden hatte, war der 12. März 1381 der Baubeginn für das neue gotische Rathaus. Der Bau, vermutlich 1433 vollendet (Aufstellung des Rolands vor dem Rathaus), war ursprünglich rund 60 m lang und 17 m breit. 1560 wurden an seiner Ostseite zum Fischmarkt hin und 1663 an der Südseite (Ratslaube) Anbauten errichtet, die den Baukörper harmonisch vervollständigten. Das Erdgeschoss war ursprünglich der Öffentlichkeit zugänglich. Seit 1998 besitzt Halberstadt an gleicher Stelle (Zerstörung am 8. April 1945 und anschließender Abriss unter dem DDR Regime) ein neues Rathaus, dessen Baukörper dem des alten Rathauses in der äußeren Form weitgehend angenähert ist.
Nachdem bereits ein Vorgängerbau bestanden hatte, war der 12. März 1381 der Baubeginn für das neue gotische Rathaus. Der Bau, vermutlich 1433 vollendet (Aufstellung des Rolands vor dem Rathaus), war ursprünglich rund 60 m lang und 17 m breit. 1560 wurden an seiner Ostseite zum Fischmarkt hin und 1663 an der Südseite (Ratslaube) Anbauten errichtet, die den Baukörper harmonisch vervollständigten. Das Erdgeschoss war ursprünglich der Öffentlichkeit zugänglich. Seit 1998 besitzt Halberstadt an gleicher Stelle (Zerstörung am 8. April 1945 und anschließender Abriss unter dem DDR Regime) ein neues Rathaus, dessen Baukörper dem des alten Rathauses in der äußeren Form weitgehend angenähert ist.
Nicht zuletzt ist auch der von 1433 stammende Roland als Zeichen einer erstarkenden und freien Stadtgemeinde anzusehen.